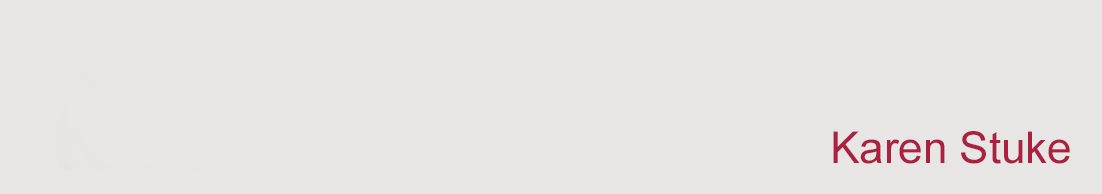von Bernd Noack
Fotografieren mit der Lochkamera ist die hohe Kunst der Zeitüberlistung. Die Bilder entstehen mit stundenlanger Belichtungszeit und zeigen die Welt, wie wir sie nie von blossem Auge sehen.

Wann sollte man aufstehen, um den Markusplatz in Venedig bei Tageslicht menschenleer fotografieren zu können? Um fünf vielleicht? Oder noch früher, vor den Tauben gar? Der Fotograf Günter Derleth macht sich gegen zehn Uhr ganz gemütlich auf. Der Platz ist natürlich längst überlaufen. Derleth ficht das nicht an. Er stellt seine Kamera auf einen kleinen Mauervorsprung, schätzt ab, ob er den Blickwinkel gut gewählt hat – und wartet. Nach einer halben Stunde packt er seinen Apparat wieder ein.
Wenn Derleth dann aber sein Bild vom Markusplatz entwickelt, wird der Platz in sanften, etwas verschwimmenden Schwarz-Weiss-Tönen in seiner ganzen Pracht zu sehen sein. Es spricht hier nur die Architektur und vor allem: Kein Mensch geht über das Pflaster, obwohl es taghell ist, keine Taube flattert auf. Selbst auf Canalettos alten Ansichten ist mehr Treiben und Leben. Bei Derleth dagegen nur Stimmung: unwirklich fast, schweigend, aber vor allem ehrfürchtig, und Venedig erscheint einem wie aus einer verlorenen Zeit herübergerettet in eine Gegenwart, die mit der Wirklichkeit gar nichts mehr zu tun hat. Man schaut auf ein reales Wunschbild und weiss, dass sich gerade im Hintergrund ein bulliges Kreuzfahrtschiff in die Perspektive schiebt.
Magische Momente
1839 präsentierte Luis Daguerre der Öffentlichkeit seine erste Fotografie. Sie zeigt den Boulevard du Temple in Paris, und in der linken unteren Bildhälfte sind schemenhaft zwei Personen zu erkennen: ein Schuhputzer und sein Kunde. Sie bewegten sich während der etwa 15-minütigen Belichtungszeit fast gar nicht und schafften es so, zumindest als undeutliche Schatten berühmt zu werden.
Was also Derleth und Daguerre gemeinsam eigen ist, könnte man auf den Nenner «Geduld» bringen: Das Fotografieren mit der Lochkamera, denn um eine solche handelt es sich in beiden Fällen, erfordert die Bereitschaft zum Warten. Um einen Gegenstand, eine Szene abzubilden, muss gehörig viel Zeit vergehen, die erstarrte Bewegung auf den Bildern zeugt nur vom Stillstand in der Realität, nur was sich nicht von der Stelle rührt, hat die Chance, später auf dem Fotopapier zu erscheinen.

Das Prinzip dieser frühen Fotoapparate, die seit einiger Zeit wieder für künstlerisch aussergewöhnliche Arbeiten verwendet werden, ist unspektakulär. Wenn durch das winzige Loch einer solchen Camera obscura Licht in den Hohlraum des Apparates dringt, vollzieht sich ein ebenso magischer wie simpler Prozess. Innen auf der Rückseite des unscheinbaren Kastens zeichnet sich auf lichtempfindlichem Material das – nun auf dem Kopf stehende – Motiv ab, auf das das Loch gerichtet war. Manipulierbar ist bei diesem Verfahren fast gar nichts, entscheidend für das, was man später auf dem Bild sehen wird, sind allein die Grösse der Öffnung vorne und die Zeit der Belichtung.
Günter Derleth war früher ein vielbeschäftigter Werbefotograf. Zweifelhaft jedoch erschienen ihm mehr und mehr die Möglichkeiten, die sich mit dem Einzug der digitalen Technik eröffneten: Bilder ohne Zahl, auf dem Display der Kamera sofort sicht- und löschbar. Am Computer ausgetüftelte und retuschierte Fotos, denen man die Lüge und die Manipulation nicht mehr ansah. Die Erinnerung an den spielerischen Umgang mit einer Lochkamera am Anfang seiner Ausbildung brachte für Derleth die Wende.
Nun zeugen die Aufnahmen von endlosen Atempausen, auf ihnen sieht man nicht nur die langsam verstreichende Zeit, sie erzählen auch etwas vom Gleichmut des Fotografen. Die Unschärfe («Als ob einem das Gewicht der Welt vor Augen vergeht», wie es bei W. G. Sebald heisst), die mitunter den Effekt der Schläfrigkeit, gar der Traumverlorenheit zaubert, nimmt allem die Härte und Endgültigkeit.

Es ist eine Welt im Schwebezustand, bestückt mit Botschaften aus der Vergangenheit, die nicht vergehen will. Nur ganz selten ist da der Mensch zu erahnen auf den Wegen durch steppenhafte Landschaften, vor den Gemäuern, auf denen die Steine langsamer zu bröckeln scheinen: Schlieren hinterlässt er, er stiehlt sich aus dem Bild, er hat nicht die Langmut, die im Verfall pausierende Ruinen als Zeichen sichtbar werden lässt, die – wie Roland Barthes einmal schrieb – «gerinnen wie Milch».
Den Alltag festhalten
Die Berliner Fotografin Karen Stuke geht bei ihrer Beschäftigung mit der alten Technik der Camera obscura noch einen Schritt weiter. Sie bezieht den Menschen mit ein. Meistens ist sie es selber, die auf ihren Fotos sichtbare, oft auch nur erahnbare Spuren hinterlässt. Wo Künstler wie Derleth vornehmlich mit und in der Natur und alten Städten arbeiten, interessiert Stuke die Inszenierung, sowohl dort, wo man sie am ehesten vermutet, also im Theater, als auch im unspektakulären eigenen Alltag.
Für ihre Serie «Sleeping Sister» hat sie sich an verschiedenen Orten (auch im kürzlich geschlossenen Hotel Bogota in Berlin, das sie bis zum letzten Tag bewohnte) schlafend abgelichtet: Nachts, über Stunden hinweg, liess sie sich von der Lochkamera beobachten, liess ihre langsamen oder unruhigen Bewegungen auf der Matratze am Boden oder in fremden Betten festhalten. Die farbigen Bilder wirken wie Malerei, abstrakt zeichnen sich die Gegenstände der Zimmer ab, dort hinten vermutet man eine Person, liegend, verborgen. Es könnte aber auch nur ein Berg Stoff sein.

Stuke zeigt so die verstrichenen Stunden, in denen überhaupt nichts Aussergewöhnliches geschieht, in einem einzigen Blick. Die Observation durch die Camera obscura gerät zu einer poetischen Variante der Überwachung. Erfahrbar beim Betrachten ist die vielstündige Ruhe, ein Gefühl der friedlichen Geborgenheit, die Abwesenheit von Spektakulärem. Und man meint die Träume herumschwirren zu sehen in den Räumen.
Als eine hoffnungslos an die Oper Verlorene brachten sie diese frühen Arbeiten mit der Lochkamera dann auf die Idee, die Motive im Theater zu suchen, dem Ort, an dem die Zeit und ihr Vergehen ja auch nur nachgespielt werden. Was geschieht aber, wenn man eine ganze Vorstellung auf ein einziges Bild bringen will? Stuke stellt den Apparat auf, richtet das kleine Loch auf die Bühne aus – und schaut sich die Inszenierung an. Später – egal, ob nach sieben Stunden «Götterdämmerung» oder neunzig Minuten «Elektra» – entwickelt sich in der Dunkelkammer auf dem Papier eine bunte Zauberwelt der Formen und Bewegungen.
Vom Guckkasten begrenzt, ist das starre Bühnenbild stets gut erkennbar, jedoch alle Aktionen der Schauspieler oder Tänzer überlagern sich, verfliessen, tauchen auf und ab, geschehen auf einmal nebeneinander. Man könne, hat einmal ein Regieassistent zu Karen Stuke gesagt, diese Bilder wie eine Partitur lesen.Es entsteht eben auch ein ganz eigenständiges Kunstwerk, das von der Möglichkeit der Gleichzeitigkeit erzählt.
Sichtbare Abwesenheit
In gewisser Weise haben Lochkamera-Bilder immer etwas mit dem Wunsch zu tun, die Abwesenheit sichtbar zu machen. In ihnen sind die Geschichten gespeichert, die geschehen sind, ohne dass sie jemand bemerkt hat. Die Bilder wollen der Vergänglichkeit Einhalt gebieten, sie widersetzen sich unserem gehetzten Gefühl vom viel zu schnellen Vergehen der Zeit und unserer Angst vor der Unwiederbringlichkeit des Augenblicks. Sie dehnen den Moment, bündeln das Nichts oder ertappen den Zufall und dokumentieren freilich oft genug nur unsere Ahnung, dass wir vielleicht etwas ganz Aussergewöhnliches versäumt haben: ein paar Minuten Stillstand der Welt.
Vor einigen Jahren hat Karen Stuke W. G. Sebalds Roman «Austerlitz» für sich entdeckt und ist losgezogen mit der Camera obscura, um den verschlungenen Weg («Ich habe beim Gehen belichtet») dieses rätselhaften jüdischen Flüchtlingskindes durch die mörderischen Gefahren des Jahrhunderts und durch ein verwirrendes Europa nachzuspüren.
Entstanden sind an Orten des Romans (die sich dem Betrachter, hat er sie gerade erst wahrgenommen, sofort wieder entziehen) verschwommene, tatsächlich «flüchtige», in ihrem tiefen Sinn verunsichernde Bilder einer Flucht, in denen keine Gewissheiten mehr Halt bieten. Es sind trotz ihrer Stille beunruhigende Fotografien, deren Sprache sichtbar macht, was Sebald schrieb – und was sich jetzt wie eine Erklärung für die einfache Kunst der die Zeit überlistenden und die Wirklichkeit in Zweifel ziehenden Lochkamera liest:
«Es scheint mir nicht, sagte Austerlitz, dass wir die Gesetze verstehen, unter denen sich die Wiederkunft der Vergangenheit vollzieht, doch ist es mir immer mehr, als gäbe es überhaupt keine Zeit, sondern nur verschiedene (. . .) ineinander verschachtelte Räume, zwischen denen die Lebendigen und die Toten, je nachdem es ihnen zumute ist, hin und her gehen können.»
Bernd Noack, NZZ, 30.3.2017