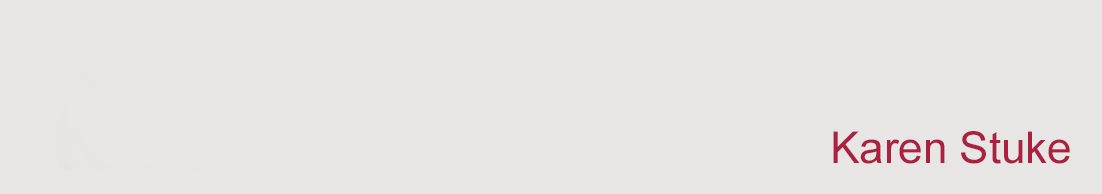von Prof. Dr. Gottfried Jäger
Die Fotografien von Karen Stuke geben vielfachen Assoziationen Raum. Da ist zuerst das Licht, das eine wichtige Rolle spielt. Es lässt Szenarien erkennen, die sich im Dunkeln ereignen. Fotografien sind Lichtbilder. Licht ist die Essenz der Fotografie, ihr eigentliches Medium. Für Karen Stuke ist es aber nicht nur das, sondern auch ihr Gegenstand, wie sich zeigt. Dann sind ihre Fotografien vom Raum bestimmt. Sie nehmen Räume auf und sie entstehen in ihnen. Man erblickt eine Bühne, ein Zimmer. Die Fotokamera selbst ist im Grunde nichts als ein dunkler Raum. Ein dritter Faktor, durch den ihre Bilder geprägt sind, ist die Bewegung. Sie erscheint flüchtig und wird nicht wie in der Momentfotografie in einem ‚entscheidenden Augenblick’ erfasst, sondern ganzheitlich und mit zeitlicher Dauer. Dabei verschwimmen die Konturen der Gegenstände. Man erkennt Bewegungen, die sich nicht durch ein einzelnes bewegtes Objekt erschließen, sondern deren Elemente irgendwie rätselhaft bleiben, der Interpretation offen. Der genaue Zugriff darauf ist ausgeschlossen. Dafür entsteht ein Gefühl von Zeit, eine Ahnung von einem Zeitrahmen, in dem das Bild ursprünglich entstand. So weist es auf seinen Herstellungsprozess zurück und reflektiert sich selbst. Licht, Raum und Zeit sind die Koordinaten, in deren Schnittfeld die Fotoarbeiten von Karen Stuke entstehen.
Ein Instrument, das diese Koordinaten in besonderer Weise bündelt, ist die Camera obscura, das von Karen Stuke seit Studienzeiten bevorzugte Werkzeug. Es handelt sich um die Urkamera, im Grunde um nichts Anderes als um eine schwarze Schachtel mit einer nadelgroßen Öffnung, dem ‚Pinhole’. Vielleicht sollte man sich ihr Prinzip zunächst ganz ursächlich vorstellen, um auf ihre Bedeutung zu kommen. Man versetze sich gedanklich in ein verdunkeltes Zimmer. Es ist Mittagszeit in einer südlichen Stadt. Die schwarzen Vorhänge sind wegen der großen Hitze und Helligkeit zugezogen. Grell beleuchtet die Sonne die gegenüberliegenden Fassaden. Nur an einer Stelle stört in der Verdunkelung ein kleines Loch, durch das ein enges Lichtbündel einfällt. Plötzlich, wie ein Schemen, erkennt man auf der entgegengesetzten Zimmerwand oder an der Zimmerdecke ein Bild, ein reelles Bild: die kopfstehende Projektion der Häuser von der anderen Straßenseite. Wenn man Glück hat, gehen dort draußen Leute, die sich hier drinnen kopfüber in der Projektion bewegen, puzzig. Das Bild ist auch farbig und scheint bei längerer Betrachtung immer realistischer zu werden. Schließlich nimmt man auch seinen Kopfstand hin und denkt es sich aufrecht, schön. Immer wieder ein kleines Wunder. Man befindet sich also in einer ‚Kamera’ und erlebt in ihrem Dämmerschein ganz unmittelbar die Genesis des fotografischen Bildes. Und auch annähernd das, was schon Plato in seinem Höhlengleichnis beschrieb. Man erkennt im Inneren der Höhle und als deren Teil einen Teil der Außenwelt – unter den Bedingungen der Höhle und ihren Verhältnissen, die man jetzt als Bedingung der eigenen Wahrnehmung in die Erkenntnis mit einbezieht, einbeziehen muss. Denn das projizierte Bild besitzt ein Eigenleben, das man kennen sollte, um es richtig einzuschätzen und angemessen wahr zu nehmen. So ist es flüchtig und wandert mit dem Gang der Sonne und verschwindet auch mit ihr. „Wir wissen, dass wir träumen“ (Vilém Flusser).
Karen Stukes Camera obscura träumt einen doppelten Traum: als Camera in einer Kamera. Geduldig und still beobachtet die Schwarze Schachtel die Inszenierung einer Theaterbühne oder eines Schlafzimmers. Über Minuten und Stunden nimmt sie die flüchtigen Bilder in sich auf und versammelt ihre Lichteindrücke auf dem Film. Es sind Langzeitbeobachtungen, in denen sich die Zeitphasen überlagern und zu einem Gesamteindruck verschmelzen. Ein ganzheitliches Bild entsteht. Es entspricht dem Eindruck, der im Gedächtnis haften bleibt und abgerufen wird, wenn man sich nach Zeiten an eine Theateraufführung erinnern mag. Sie hinterlässt den Bildeindruck von Helligkeiten, Dunkelheiten, von spontaner Bewegung oder ruhigem Fluss, von Buntheit oder grauen Szenen. Weniger scheinen dagegen Einzelheiten auf. Vielleicht doch das eine oder andere Detail, wenn es besonders prägnant auftrat oder die ganze Zeit über still verharrte und so einen bleibenden Eindruck hinterließ. Auch solche Momente sind in den Fotos zu erkennen und geben ihnen Halt und dem Blick auf sie eine gewisse Orientierung, so dass sie – bei aller Abstraktheit – doch auch wieder ganz realistisch wirken. Nicht im Hinblick auf die Fixierung eines konkreten Geschehens vor der Kamera, als vielmehr im Hinblick auf die Wahrnehmung und Speicherung dessen im eigenen Gedächtnis. Es sind nicht direkte Abbilder sondern Bildreflexe, die auf diese Weise zustande kommen, indexikalische Zeichen, die die eigenen Verhältnisse thematisieren und sie gestaltend in sich einschließen. Das Konzept des Bildes bestimmt seine Form und Gestalt.
Ganz überraschend wirken in diesem Oevre die Schlafbilder, in denen sich die Fotografin über Nacht selbst beobachtet. Es vergehen Stunden, während derer die Camera, still gestellt und mit geöffnetem Verschluss, die Eindrücke der Dunkelheit nach und nach sammelt und speichert. Erst gegen Morgen wird ihr intimer Blick beendet, der Tag beginnt. Zurück bleiben langsame, friedliche Bilder auf der Grenze zwischen Nähe und Distanz, zwischen Tag und Traum – doch an die Träume der jungen Frau kommt ihre stumme Zeugin nicht heran.
Eine zentrale Rolle in den Arbeiten von Karen Stuke spielt nach ihren Selbstaussagen die Theaterfotografie. Darin ist sie durch ihr Elternhaus geprägt. So erhielt sie früh Einblick in die Theaterszene und wurde mit ihren Personen und mit ihrer Sprache vertraut. Ein Theaterpraktikum vertiefte die Beziehung. Sie kennt sich schon aus. Als ich im Seminar einmal beiläufig erwähnte, auf Malta Ferien machen zu wollen, empfahl sie mir dringend das Theater auf der kleinen Nachbarinsel Gozo… Ihre Diplomarbeit bestand neben dem experimentellen Teil ihrer ‚Opera obscura’-Bilder aus einer ansehnlichen Dokumentation von Inszenierungen des international renommierten Bühnenbildners und Regisseurs Gottfried Pilz, dessen Werk sie bis heute rund um den Globus fotografiert. Er arbeitete damals zusammen mit dem Oberspielleiter John Dew unter dem Intendanten Heiner Bruns und trug mit zum „Bielefelder Opernwunder“ bei. Durch Wiederentdeckungen der von den Nazis als ‚entartet’ verbotenen Zeitopern wurde die Stadt in den 1980er, 1990er Jahren zu einer bedeutenden Metropole des deutschen Musiktheaters. Auch diese Umstände in der unmittelbaren Nähe ihres Studienplatzes prägten sie. In Kenntnis der ungeschriebenen Geschichte der Theaterfotografie – von der Gründgens-Fotografin Rosemarie Clausen über den unbändigen Chargesheimer bis zu den farbigen Tanzimpressionen Walter Bojes –, wollte Karen Stuke, das ‚andere’, das absolute Theaterfoto machen. Das Bild, das alles in sich vereint, die ganze Szene, den ganzen Akt, das ganze Programm. So kam sie fast zwangsläufig zu dem anachronistisch langsamen Instrument, das dies ermöglicht und mit dem sie inzwischen so verwachsen ist, dass sie es garnicht mehr als etwas Besonderes empfindet – so virtuos, wie sie es beherrscht. Dass die daraus entstandenen Bilder ‚anders’ sind, ist unabweisbar. Ob sie angemessen und ‚richtig’ sind, ist unbeweisbar. Sie sind der sichtbare Ausdruck eines tiefen Wunsches, der fantastischen Welt des Theaters ein fantastisches Bild der Fotografie entgegenzusetzen. Ihre Inszenierung ist eine doppelt und dreifache. Auf die Inszenierung der Bühne reagiert sie mit der Inszenierung der Kamera, der die Inszenierung des Bildes in bühnenähnlichen Kästen folgt. Ein eigenes Bildsystem entsteht.
In ihrer jüngsten Werkgruppe, ‚City Lights’, setzt Karen Stuke das Licht nicht nur als szenisches Hilfsmittel ein, sondern als generative Instanz, die autonome Bildstrukturen erzeugt. Sie erinnern kaum mehr an einen Gegenstand und auch die Art ihrer Hervorbringung tritt in den Hintergrund. Allein die Bewegungsdimension bleibt dem kundigen Auge nicht verborgen und bildet so ein Erklärungsmuster und eine Konstante in dem bildnerischen Spiel der reisefreudigen Fotografin. Hier bewegt sie sich selbst. Sie installiert ihre Camera auf den mächtigen Drehtürmen, wie sie mit meist schick eingerichteten Restaurants hoch über den Metropolen der Welt, wie in Berlin, New York oder dem japanischen Kobe, ein schwindelerregendes Dasein führen. Beim entgrenzten Blick in die Tiefe ziehen die ruhenden Lichter der Großstadt an uns vorbei. Das Bild wechselt ständig. Doch was sich ändert und bewegt, sind wir selbst. Das Fotoauge bleibt gelassen. Es registriert nach eigenem Ermessen und lässt über Raum und Zeit hinweg in seinem Inneren ein exklusives Bild entstehen. Es ist nicht weniger wahr, gut und schön, als unser eigenes. Nur anders.
Prof. Dr. Gottfried Jäger, 2007
Aus dem Buch:
„Die Trilogie der schönen Zeit, oder: Warten macht mir nichts aus!“